Kontakt
Raum:
Giselastr. 10
Telefon:
+49 (0)89 2180-5245
E-Mail:
dieter.frey@psy.lmu.de
Kurzprofil
Prof. Dr. Dieter Frey ist Leiter des LMU Centers for Leadership and People Management und ehemaliger Inhaber des Lehrstuhls für Sozial- und Wirtschaftspsychologie der LMU München. Er publizierte in hochrangigen Journals zu Themen wie Entscheidungsverhalten und Informationsaufnahme, Motivation, ethikorientierte Führung, Innovation, Zivilcourage, Fairness, Entstehung und Veränderung von Werten und verfasste psychologische Analysen historischer Ereignisse, etwa zum Nationalsozialismus und Holocaust, zu Genesungsfaktoren nach Unfällen und schweren Krankheiten u.v.m. Seit vielen Jahren ist er außerdem als Berater und Trainer zu diesen Themen in Wissenschaft und Wirtschaft aktiv. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht und ist Mitherausgeber der 100-bändigen Enzyklopädie für Psychologie im Hogrefe Verlag. Er war langjähriger Akademischer Leiter der Bayerischen EliteAkademie. Er ist Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und wurde 1998 zum Deutschen Psychologie-Preisträger gewählt. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u. a. von der Dr. Margrit Egnér-Stiftung der Universität Zürich für seine Forschung, die zu einer humaneren Welt beiträgt. 2020 und 2021 wurde der Sozial- und Wirtschaftspsychologe von der FAZ zu den 100 einflussreichsten Ökonomen im deutschsprachigen Raum gezählt.
Ausführlicher Lebenslauf
Wegweisende wissenschaftliche Erkenntnisse (Auswahl)
Grundlagenforschung:
- Entwicklung von neuen Theorien und Weiterentwicklung von bestehenden Theorien (Auswahl):
- Weiterentwicklung der Theorie der kognizierten Kontrolle (mit den Faktoren Erklärbarkeit, Vorhersagbarkeit, Beeinflussbarkeit)
- Theorie der gelernten Sorglosigkeit
- Sinntheorie
- Theorie der Extension
- Experimentelle Studien zur empirischen Fundierung bestehender Theorien (Auswahl):
- Theorie der kognitiven Dissonanz bei Individuen und Gruppen (Informationssuche und Bewertung bei Entscheidungen)
- Theorie der kognizierten Kontrolle
- Theorie des Selbstwertschutzes und der Selbstwerterhöhung
Angewandte Forschung (Auszüge):
- Erfolgsdreieck der Führung: Umsetzung von drei Kulturen: Exzellenzkultur, Wertschätzungskultur, Kultur von ethikorientierter Führung mit den vier Vs: Vorbild, Verantwortung, Verpflichtung, Vertrauen
- Prinzipienmodell der Führung von Frey: Herstellung von Rahmenbedingungen zur intrinsischen Motivation - Führung als entscheidender Faktor von Motivation und Demotivation der Mitarbeitenden: Vermittlung von Sinn und Vision, Transparenz durch Information und Kommunikation, Fairness und Vertrauen, Autonomie und Partizipation, konstruktives Feedback durch Lob und Korrektur, Wertschätzung, Ziel- und Erwartungsklarheit, Sicherheit, Entwicklungs- und Wachstumsmöglichkeiten, gutes Teamklima, Vorbild von Führung u.v.m.
- Genesung nach Krankheiten und Unfällen: Der positive Einfluss von Bewältigungs- vs. Hilflosigkeitsmustern beim Genesungsprozess (Resilienz und Kontrollerleben)
- Umsetzung von Erkenntnissen der positiven Psychologie und Aktivierung der personalen und sozialen Ressourcen: Optimismus, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, Herausforderungsdenken, Hoffnung, soziales Netzwerk
- Erfolgsfaktoren von Veränderungsprozessen
- Reduktion des Groupthink-Phänomens
- Entstehung und Umsetzung von Werten in der Wirtschaft und in der Wissenschaft
- Anwendung der Kontrolltheorie zur Erklärung des Nationalsozialismus und Holocaust
- Fairness: Zusammenhang zwischen vier Arten von Fairness und Motivation und Innovation:
- Ergebnisfairness: Aufteilung von Positiv- und Negativressourcen,
- Verfahrensfairness mit voice: Was sind die Kriterien, die zum Ergebnis geführt haben,
- Informationsfairness: rechtzeitig, umfassend, ehrlich,
- Interaktionsfairness: Interaktion auf gleicher Augenhöhe.
Anwendung von Forschung – Nichts ist praktischer als eine gute Theorie:
- Innovation: Wirksamkeit von sog. Center of Excellence Kulturen als Voraussetzung für Innovationen: Problemlösekultur, Fehlerkultur, Streit – und Konfliktkultur, Innovationskultur, Kundenorientierungskultur, Benchmarkkultur, Implementierungskultur, Zivilcouragekultur, Rekreationskultur, Mitarbeiterorientierungskultur usw.
- Transfer psychologischer Erkenntnisse in die Praxis: Menschen als wirtschaftliche Akteure (Führungskräfte, Unternehmer, Aktionäre, Konsumenten, Sparer)
- Führung in der Praxis; Vermittlung von Tools wie Fünf-Minuten-Gespräche, Berücksichtigung der Multiplikatoren, Teamreflexion, Anwendung der Impftheorie, Kunst der Pause
- Transfer von Erfolgsfaktoren von Teams in der Wirtschaft über Teams auf Mannschaftssport
- Zivilcourage: Wirksamkeit von Trainings mit der Vermittlung von Wissen, Handlungskompetenzen und Werten
- Analyse über Psychologie der Märchen, Sprichwörter, Sitten und Bräuche sowie über Gut und Böse zur Klärung des psychologischen Backgrounds von Alltagsphänomenen: Psychologie der großen Alltagsphänomene: Was weiß die moderne Forschung über Märchen, Sprichwörter, Rituale, Werte, das Gute und Böse?
Ausführliche Beschreibung der Forschungsinhalte
Wissenschaftliche Veröffentlichungen geordnet nach Themen von A-Z (Auswahl)
Führung:
Braun, S., Peus, C., Weisweiler, S., & Frey, D. (2013). Transformational leadership, job satisfaction, and team performance. A multilevel mediation model of trust. The Leadership Quarterly, 24(1), 270-283.
Brodbeck, F. C., Maier G., & Frey, D. (2002). Führungstheorien. In D. Frey & M. Irle (Hrsg.), Theorien der Sozialpsychologie: Band II (S. 327-363). Huber.
Frey, D. (2015). Ethische Grundlagen guter Führung. Warum gute Führung einfach und schwierig zugleich ist. Roman-Herzog-Institut München.
Frey, D., Gerkhardt, M., Fischer, P., Peus, C., & Traut-Mattausch, E. (2009). Change Management in Organisationen – Widerstände und Erfolgsfaktoren der Umsetzung. In L. v. Rosenstiel, E. Regnet & M. Domsch (Hrsg.), Führung von Mitarbeitern – Handbuch für erfolgreiches Personalmanagement (S. 561-572). Schaeffer-Poeschel.
Frey, D., Nikitopoulos, A., Peus, C., Weisweiler, S., & Kastenmueller, A. (2010). Unternehmenserfolg durch ethikorientierte Unternehmens- und Mitarbeiterführung. In U. Meier & B. Sill (Hrsg.), Führung. Macht. Sinn. (S. 604-623). Pustet.
Frey, D., & Schmalzried, L. (2013). Philosophie in der Führung – Gute Führung lernen von Kant, Aristoteles, Popper & Co. Springer.
Peus, C., Wesche, J. S., Streicher, B., Braun, S., & Frey, D. (2012). Authentic leadership: An empirical test of its antecedents, consequences, and mediating mechanisms. Journal of Business Ethics, 107(3), 331-348.
Genesung nach Krankheiten oder Unfällen:
Frey, D. (1992). To what extent is the recuperation process of accident patients dependent on psychological factors? In L. Montada, S.-H. Filipp, & M. Lerner (Eds.), Life crises and experiences of loss in adulthood (pp.57-63). Erlbaum.
Frey, D., & Rogner, O. (1987). The relevance of psychological factors in the convalescence of accident patients. In G. R. Semin & B. Krahé (Eds.), Issues in Contemporary German Social Psychology (pp. 241-257). Sage Publications.
Frey, D., Rogner, O., & Havemann, D. (1989). Psychological Factors Influencing the Recuperation Process of Accident Patients. In P. F. Lovibond & P. H. Wilson (Eds.), Clinical and Abnormal Psychology (pp. 481-485). Elsevier.
Gruppen und Gruppenprozesse:
Braun, S., Frey, D., Brodbeck, F. C., & Hentschel, T. (2015). Group Processes in Organizations. In J. D. Wright (Ed.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (vol. 10, pp. 408–415). Elsevier.
Brodbeck, F. C., Kerschreiter, R., Frey, D., & Schulz-Hardt, S. (2006). Gruppenleistung. In H.-W. Bierhoff & D. Frey (Hrsg.), Handbuch der Sozialpsychologie und Kommunikationspsychologie (S. 638-645). Hogrefe.
Frey, D., & Brodbeck, F. C. (2002). Group processes in organisations. In N. J. Smelser & P. Baltes (Eds.), International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences (vol. 9, pp. 6407–6413). Elsevier Science.
Schulz-Hardt, S., Brodbeck, F. C., Mojzisch, A., Kerschreiter, R., & Frey, D. (2006). Group Decision Making in Hidden Profile Situations: Dissent as a Facilitator for Decision Quality. Journal of Personality and Social Psychology, 6, 1080-1093.
Hilfeverhalten und Zivilcourage:
Fischer, P., Krueger, J., Greitemeyer, T., Vogrincic, C., Kastenmüller, A., Frey, D., Heene, M., Wicher, M., & Kainbacher, M. (2011). The Bystander-Effect: A Meta-Analytic Review on Bystander Intervention in Dangerous and Non-Dangerous Emergencies. Psychological Bulletin, 137(4), 517-537.
Frey, D., Brandstätter, V., Peus, C., & Winkler, M. (2004). Zivilcourage: Intoleranz gegenüber Intoleranz. In H.R. Yousefi & K. Fischer (Hrsg.), Interkulturelle Orientierung - Grundlegung des Toleranz-Dialogs. Teil II: Angewandte Interkulturalität (Bd.6/II , S. 431-452). Bautz.
Frey, D., Greitemeyer, T., Fischer, P., & Niesta, D. (2005). Psychologische Theorien hilfreichen Verhaltens. In K. J. Hopt, T .v. Hippel & W. R. Walz (Hrsg.), Non-Profit-Organisationen in Recht, Wirtschaft und Gesellschaft (S. 177-196). Mohr Siebeck.
Frey, D., Neumann, R., & Schäfer, M. (2001). Determinanten der Zivilcourage und des Hilfeverhaltens. In H.-W. Bierhoff & D. Fetchenhauer (Hrsg.), Solidarität, Konflikt, Umwelt und Dritte Welt (S. 93-122). Leske + Budrich.
Frey, D., Peus, C., Brandstätter, V., Winkler, M. & Fischer, P. (2006). Zivilcourage. In H.-W. Bierhoff & D. Frey (Hrsg.), Handbuch der Sozialpsychologie und Kommunikationspsychologie (S. 180-186). Hogrefe.
Frey, D., Winkler, M., Fischer, P., Bruckmeier, N., Glöckner, P., König, W., Mutz, D., & Spies, R. (2007). "zammgrauft" - Ein Training von Anti-Gewalt bis Zivilcourage für Kinder und Jugendliche. In K. J. Jonas, M. Boos & V. Brandstätter (Hrsg.), Zivilcourage trainieren! Theorie und Praxis (S. 139-203). Hogrefe.
Informationsverarbeitung und Entscheidungen:
Frey, D. (1986). Recent research on selective exposure to information. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology (pp. 41-80). Academic Press.
Jonas, E., Schulz-Hardt, S., Frey, D., & Thelen, N. (2001). Confirmation bias in sequential information search after preliminary decisions: An expansion of dissonance theoretical research on “selective exposure to information”. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 557-571.
Schulz-Hardt, S., Frey, D., Lüthgens, C., & Moscovici, S. (2000). Biased Information Search in Group Decision Making. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 655-699.
Schulz-Hardt, S., Jochims, M. & Frey, D. (2002). Productive conflict in group decision making: Genuine and contrived dissent as strategies to counteract biased information seeking. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 88, 563-586.
Innovation:
Frey, D., Greitemeyer, T., & Traut-Mattausch, E. (2008). Psychologie der Kreativität und Innovation angewandt auf soziale und kommerzielle Organisationen. In G. v. Graevenitz & J. Mittelstraß (Hrsg.), Kreativität ohne Fesseln: über das Neue in Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur (S. 29-55). UVK Verlagsgesellschaft.
Frey, D., & Kodalle, K.-M. (2008). Beschleunigung, Innovation und die Angst vor Veränderung. Über das Erfordernis einer neuen Kommunikationskultur. In K.-M. Kodalle & H. Rosa (Hrsg.), Rasender Stillstand (S. 103- 120). Königshausen und Neumann.
Peter, T., Frey, D., Mundt, J., Streicher, B., & Hörner, K. (2017). Innovation - Definition, Prozess und förderliche Faktoren. In H.-W. Bierhoff & D. Frey (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie: Sozialpsychologie, Kommunikation, Interaktion und Soziale Gruppenprozesse (Bd. 3, S. 299-339). Hogrefe.
Rosenstiel, L. v. & Frey, D. (2010). Was fördert Innovation im Unternehmen? In R. Oerter, D. Frey, H. Mandl, L. v. Rosenstiel & K. Schneewind (Hrsg.), Neue Wege wagen: Innovation in Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft (S. 107-137). Lucius & Lucius.
Lehrbücher:
Bierhoff, H.-W., & Frey D. (Hrsg.) (2006). Handbuch der Sozialpsychologie und Kommunikationspsychologie. Hogrefe.
Bierhoff, H.-W., & Frey D. (Hrsg.) (2011). Bachelorstudium Psychologie: Sozialpsychologie – Individuum und soziale Welt. Hogrefe.
Bierhoff, H.-W., & Frey, D. (Hrsg.) (2016). Enzyklopädie der Psychologie: Sozialpsychologie – Selbst und soziale Kognition (Bd. 1). Hogrefe.
Bierhoff, H.-W., & Frey, D. (Hrsg.) (2016). Enzyklopädie der Psychologie: Sozialpsychologie – Soziale Motive und soziale Einstellungen (Bd. 2). Hogrefe.
Bierhoff, H.-W., & Frey, D. (Hrsg.) (2017). Enzyklopädie der Psychologie: Sozialpsychologie - Kommunikation, Interaktion und Soziale Gruppenprozesse (Bd. 3). Hogrefe.
Frey, D., & Bierhoff, H.-W. (Hrsg.) (2011). Bachelorstudium Psychologie: Sozialpsychologie – Interaktion und Gruppe. Hogrefe.
Frey, D., & Graf Hoyos, C. (Hrsg.) (2005). Psychologie in Gesellschaft, Kultur und Umwelt. Beltz.
Frey, D., & Irle, M. (Hrsg.) (2002a). Theorien der Sozialpsychologie. Band I: Kognitive Theorien (2. Aufl.). Huber.
Frey, D., & Irle, M. (Hrsg.) (2002b). Theorien der Sozialpsychologie. Band II: Gruppen-, Interaktions- und Lerntheorien (2. Aufl.). Huber.
Frey, D., & Irle, M. (Hrsg.) (2002c). Theorien der Sozialpsychologie. Band III: Motivations-, Selbst- und Informationsverarbeitungstheorien (2. Aufl.). Huber.
Frey D., Rosenstiel v. L., & Graf Hoyos, C. (Hrsg.) (2005). Wirtschaftspsychologie. Beltz.
Graf Hoyos, C., & Frey, D. (Hrsg.) (1999). Arbeits-, und Organisationspsychologie: Ein Lehrbuch. Psychologie Verlags Union.
Rosenstiel, L. v., & Frey, D. (Hrsg.) (2007). Enzyklopädie der Psychologie, Wirtschafts-, Organisations- und Arbeitspsychologie, Band 5: Marktpsychologie. Hogrefe.
Neu entwickelte Theorien:
Frey, D., & Schulz-Hardt, S. (2015a). Gelernte Sorglosigkeit. In M. Galliker & U. Wolfradt (Hrsg.), Kompendium sozialpsychologischer Theorien (S. 151-153). Suhrkamp.
Frey, D., & Schulz-Hardt, S. (2015b). Modell der Extension. In M. Galliker & U. Wolfradt (Hrsg.), Kompendium sozialpsychologischer Theorien (S. 302-305). Suhrkamp.
Frey, D., & Schulz-Hardt, S. (1999). Extension: Ein Modell zur Erklärung und Vorhersage der Ausdehnungsbestrebungen von Individuen, Gruppen und größeren sozialen Systemen. In W. Hacker & M. Rinck (Hrsg.), Zukunft gestalten - Bericht über den 41. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Dresden 1998 (S. 216-228). Pabst Science Publishers.
Frey, D., Ullrich, B., Streicher, B., Schneider, E., & Lermer, E. (2016). Theorie der gelernten Sorglosigkeit. In D. Frey & H.-W. Bierhoff (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie: Sozialpsychologie – Selbst und soziale Kognition (Bd. 1, S. 429-469). Hogrefe.
Remus, J., & Frey, D. (2016). Der Wille zum Sinn: Die psychologische Bedeutung der Sinnfindung. In H.-W. Bierhoff, & D. Frey (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie: Sozialpsychologie – Selbst und soziale Kognition (Bd. 1, S. 509-531). Hogrefe.
Schulz-Hardt, S., & Frey, D. (2015). Sinnprinzip. In M. Galliker & U. Wolfradt (Hrsg.), Kompendium sozialpsychologischer Theorien (S. 425-428). Suhrkamp.
Lehre zu sozialpsychologischen Theorien: Dissonanztheorie, Kontrolltheorie, Selbstwertschutztheorie:
Dauenheimer, D., Stahlberg, D., Frey, D., & Petersen, L. E. (2002). Die Theorie des Selbstwertschutzes und der Selbstwerterhöhung. In D. Frey & M. Irle (Hrsg.), Theorien der Sozialpsychologie. Band III: Motivations-, Selbst- und Informationsverarbeitungstheorien (S. 159-190). Huber.
Frey, D., & Gaska, A. (1993). Die Theorie der kognitiven Dissonanz. In D. Frey & M. Irle (Hrsg.), Kognitive Theorien der Sozialpsychologie (2. vollständig überarbeitete Auflage, S. 275-325). Huber.
Frey, D., & Jonas, E. (2002). Die Theorie der kognizierten Kontrolle. In D. Frey & M. Irle (Hrsg.), Theorien der Sozialpsychologie. Band III: Motivations-, Selbst- und Informationsverarbeitungstheorien (S. 13-50). Huber.
Fritsche, I., Jonas, E., & Frey, D. (2016). Das Bedürfnis nach Kontrolle als soziale Motivation. In H.-W. Bierhoff & D. Frey (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie: Sozialpsychologie – Soziale Motive und soziale Einstellungen (Bd. 2, S. 54-78). Hogrefe.
Kuonath, A., Frey, D., & Schmidt-Huber, M. (2016). Selbstwert. In H.-W. Bierhoff & D. Frey (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie: Sozialpsychologie – Selbst und soziale Kognition (Bd. 1, S. 213-232). Hogrefe.
Peus, C., Frey, D., & Stöger, H. (2006). Theorie der kognitiven Dissonanz. In H.-W. Bierhoff & D. Frey (Hrsg.), Handbuch der Sozialpsychologie und Kommunikationspsychologie (S. 373-379). Hogrefe.
Vogrincic-Haselbacher, C., Asal, K., Fischer, P., & Frey, D. (2016). Theorie der kognitiven Dissonanz. In H.-W. Bierhoff & D. Frey (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie: Sozialpsychologie – Soziale Motive und soziale Einstellungen (Bd. 2, S. 469-490). Hogrefe.
Leistung und Exzellenz:
Frey, D. (1996a). Notwendige Bedingungen für dauerhafte Spitzenleistungen in der Wirtschaft und im Sport: Parallelen zwischen Mannschaftssport und kommerziellen Unternehmen. In A. Conzelmann, H. Gabler & W. Schlicht (Hrsg.), Soziale Interaktionen und Gruppen im Sport (S. 3-28). bps-Verlag.
Frey, D. (1996b). Psychologisches Know-how für eine Gesellschaft im Umbruch - Spitzenunternehmen der Wirtschaft als Vorbild. In C. Honegger, J. M. Gabriel, R. Hirsig, J. Pfaff-Czarnecka, & E. Poglia (Hrsg.), Gesellschaften im Umbau. Identitäten, Konflikte, Differenzen (S. 75-98). Seismo-Verlag.
Frey, D., Bürgle, N., & Uemminghaus, M. (2021). Eine Vision exzellenter Lehre: 11 Anforderungen an Dozierende. In D. Frey & M. Uemminghaus (Hrsg.) (2021), Innovative Lehre an der Hochschule. Konzepte, Praxisbeispiele und Lernerfahrungen aus COVID-19 (S. 18-29). Springer.
Frey, D., Jauch, K-W. & Stockkamp, M. (Hrsg.) (2020). Mit Erfolg zur Professur oder Dozentur – ein Karriereratgeber mit 180 Fragen und Antworten. Springer.
Frey, D., Streicher, B., & Aydin, N. (2012). Center of Excellence Kulturen sowie professionelle ethikorientierte Führung als Voraussetzung für ökonomischen Erfolg. In S. Grote (Hrsg.), Die Führung der Zukunft (S. 235-253). Springer.
Nationalsozialismus:
Frey, D. & Rez, H. (2002). Population and Predators: Preconditions for the Holocaust from a Control-Theoretical Perspective. In L. S. Newman & R. Erber (Eds.), Understanding Genocide: The Social Psychology of the Holocaust (pp. 188-221). Oxford University Press.
Frey, D., Rez, H., & Hehnen, M. (2022). Weimar, Hitler und „die Deutschen“ – ein sozialpsychologisches Bedingungssystem. Akklamation und Aufstieg der nationalsozialistischen Bewegung im Lichte der Theorie der kognizierten Kontrolle. Psychologische Rundschau, 73(2), 99-119.
Psychologie in der Praxis und Psychologie der Alltagsphänomene:
Frey, D. (Hrsg.) (2016a). Psychologie der Werte. Von Achtsamkeit bis Zivilcourage - Basiswissen aus Psychologie und Philosophie. Springer.
Frey, D. (Hrsg.) (2017). Psychologie der Sprichwörter. Weiß die Wissenschaft mehr als Oma? Springer.
Frey, D. (Hrsg.) (2017). Psychologie der Märchen. 41 Märchen wissenschaftlich analysiert - und was wir heute aus ihnen lernen können. Springer.
Frey, D. (Hrsg.) (2018). Psychologie der Rituale und Bräuche. 30 Riten und Gebräuche wissenschaftlich analysiert und erklärt. Springer.
Frey, D. (Hrsg.) (2019). Psychologie des Guten und Bösen. Licht- und Schattenfiguren der Menschheitsgeschichte – Biografien wissenschaftlich beleuchtet. Springer.
Frey, D. & Uemminghaus, M. (Hrsg.) (2021). Innovative Lehre an der Hochschule. Konzepte, Praxisbeispiele und Lernerfahrungen aus COVID-19. Springer.
Positive Psychologie und Fairness:
Frey, D., Gaska, A., Möhle, C., & Weidemann, J. (1991). Age is just a matter of mind: Zur (Sozial-)-Psychologie des Alterns. In J. Haisch & H.-P. Zeitler (Hrsg.), Gesundheitspsychologie. Zur Sozialpsychologie der Prävention und Krankheitsbewältigung (S. 87-108). Asanger.
Frey, D., Jonas, E., & Greitemeyer, T. (2002). Intervention as a major tool of a psychology of human strength: Examples from organizational change and innovation. In L. G. Aspinwall & U. M. Staudinger (Eds.), A psychology of human strength: Perspectives on an emerging field (S. 149-164). American Psychological Association.
Frey, D., Streicher, B., & Klendauer, R. (2004). Relevanz von distributiver, prozeduraler, informationaler und interpersonaler Fairness im Prozess des Marketings gegenüber internen und externen Kunden. In K.-P. Wiedmann (Hrsg.), Fundierung des Marketings (S. 137-154). Gabler Edition Wissenschaft.
Frey, D., Osswald, S., Peus, C., & Fischer, P. (2006). Positives Management, ethikorientierte Führung und Center of Excellence: Wie Unternehmenserfolg und Entfaltung der Mitarbeiter durch neue Unternehmens- und Führungskulturen gefördert werden können. In M. Ringlstetter, S. Kaiser & G. Müller-Seitz (Hrsg.), Positives Management (S. 237-265). Gabler: Edition Wissenschaft.
Streicher, B., Frey, D., & Öttl, M. (2017). Gerechtigkeit. In H.-W. Bierhoff & D. Frey (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie: Sozialpsychologie - Kommunikation, Interaktion und Soziale Gruppenprozesse (Bd. 3, S 901-937). Hogrefe.
Werte:
Frey, D., Frey, A., Peus, C., & Osswald, S. (2008). Warum es so leicht ist, Werte zu proklamieren und so viel schwieriger, sich auch entsprechend zu verhalten. In E. Rohmann, M. J. Herner & D. Fetchenhauer (Hrsg.), Sozialpsychologische Beiträge zur Positiven Psychologie (S. 226-247). Pabst.
Frey, D. & Graupmann, V. (2011). Werte vermitteln – Sozialpsychologische Modelle und Strategien. In R. Klein & B. Görder (Hrsg.), Werte und Normen im beruflichen Alltag. Bedingungen für ihre Entstehung und Durchsetzung (S. 25-44). LIT-Verlag.
Frey, D., Graupmann, V., & Fladerer, M. P. (2016). Zum Problem der Wertevermittlung und der Umsetzung in Verhalten. In D. Frey (Hrsg.), Psychologie der Werte (S. 307-319). Springer.
Wissenschaftstheorie:
Frey, D., Schmalzried, L. , Jonas, E., Fischer, P., & Dirmeier, G. (2011). Wissenschaftstheorie und Psychologie: Einführung in den Kritischen Rationalismus von Karl Popper. In D. Frey & H.-W. Bierhoff (Hrsg.), Bachelorstudium Psychologie: Sozialpsychologie - Interaktion und Gruppe (S. 285-303). Hogrefe.
Schmalzried, L., Frey, D., Agthe, M., Aydin, N., Lermer, E., & Pfundmair, M. (2016). Wissenschaftstheorie und Sozialpsychologie. In H.-W. Bierhoff & D. Frey (Hrsg.) Enzyklopädie der Psychologie: Sozialpsychologie – Selbst und soziale Kognition (Bd. 1, S. 3-20). Hogrefe.
Zusammenhang zwischen Psychologie und Ökonomie:
Frey, D., Brandstätter, V. & Schuster, B. (1994). Das ökonomische Modell aus psychologischer Sicht. In C. Smekal & E. Thearl (Hrsg.). Stand und Entwicklung der Finanzpsychologie. Nomos Verlagsgesellschaft. 65-106.
Frey, D. & Gülker, G. (1988). Psychologie und Volkswirtschaftslehre: Möglichkeiten einer interdisziplinären Zusammenarbeit. In E. Boettcher, P. Herder-Dorneich & K.-E. Schenk (Hrsg.). Jahrbuch für Neue Politische Ökonomie. Band 7: Interdisziplinarität - Voraussetzungen und Notwendigkeiten. J.C.B. Mohr. 168-191.
Frey, D. & Stahlberg, D. (1990). Erwartungsbildung und Erwartungsänderungen bei Börsenakteuren. In P. Maas & J. Weibler (Hrsg.). Börse und Psychologie - Plädoyer für eine neue Perspektive. Deutscher Instituts-Verlag. 102-139.
Jonas, E., Heine, K., & Frey, D. (1999). Ein Modell der Steuerzufriedenheit - psychologische Grundlagen (un)ökonomischen Handelns. In L. Fischer, T. Kutsch & E. Stephan (Hrsg.). Finanzpsychologie. Oldenbourg. 160-187.
Greitemeyer, T., Traut-Mattausch, E., & Frey, D. (2008). Psychologische Konsequenzen der Euro-Einführung. Roman-Herzog-Institut.
Lenz, A., Frey, D. & Rosenstiel, L. v. (2010). Schöpferische Zerstörung und zerstörerische Schöpfung wie Finanzinnovationen wesentlich zur internationalen Finanzkrise beitrugen. In R. Oerter, D. Frey, H. Mandl, L. v. Rosenstiel & K. Schneewind (Hrsg.): Neue Wege wagen: Innovation in Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft. 139-161. Lucius & Lucius.
Gesamtpublikationen chronologisch geordnet
Gesamtpublikationen thematisch geordnet
Medienpräsenz- Prof. Dr. Dieter Frey im Interview
- mit dem Institut zur Fortbildung von Betriebsräten (ifb KG)
- zum Thema Positive Psychologie
- zum Thema Exzellente Kommunikation
Laudatio für Dieter Frey zum Martin-Irle-Preis 2016 der Deutschen Gesellschaft für Psychologie
Laudatio für Dieter Frey: Preisverleihung 2016 "Arbeit und Organisation: Der Mensch im Mittelpunkt" der Dr. Margrit Egnér-Stiftung
Publikationen in Zeitungen
Bücher im Hogrefe-, Huber- und Springer-Verlag






Link zum Buch Link zum Buch Link zum Buch
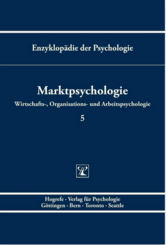

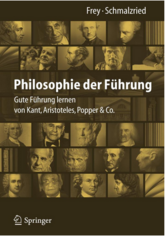
Link zum Buch Link zum Buch Link zum Buch


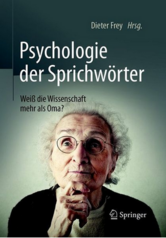
Link zum Buch Link zum Buch Link zum Buch
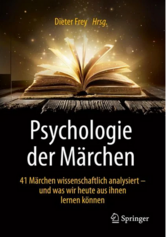
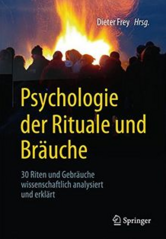
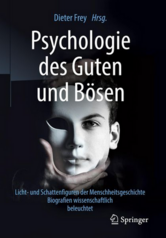
Link zum Buch Link zum Buch Link zum Buch
Weitere Bücher im Springer-Verlag:
- Frey, D., Jauch, K.W., & Stockkamp, M.T. (2020) (Hrs.). Mit Erfolg zur Professur und Dozentur: Ein Karriereratgeber mit über 180 Fragen und Antworten. Springer.
- Frey, D. & Uemminghaus, M. (Hrsg.) (2021). Innovative Lehre an der Hochschule. Konzepte, Praxisbeispiele und Lernerfahrungen aus COVID-19. Springer.


